Quellen der Erkenntnis? Zur Kunstliteratur der Frühen Neuzeit
|
Tagung des Instituts für Kunstgeschichte der LMU in Zusammenarbeit mit dem Zentralinstitut für Kunstgeschichte, München München, 21. und 22. November 2008 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Home | Programm | Info und Anmeldung | Anreise | ||
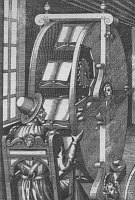 Julius
von Schlossers Buch „Die Kunstliteratur“ (Wien 1924) ist ein 'Klassiker' der
Kunstwissenschaft. Dabei wollte Schlosser selbst seine Darstellung in
doppelter Hinsicht relativiert sehen: Zum einen sei nur ein Teilbereich der
kunsthistorischen Quellen erfasst. Zum anderen habe er sein eigentliches
Ziel, eine „Theorie und Geschichte der Kunstgeschichtsschreibung“, nur
andeuten können. Zu beiden Aspekten wurden seitdem entscheidende Beiträge
geliefert. Der Blick auf einzelne Texte, Gattungen, literarische Strukturen
und Zusammenhänge (Künstlerbiographie; ut pictura poesis) ist geschärft und
erweitert worden. Dennoch gibt es keine neue übergreifende Gesamtschau, die
Schlossers Darstellung ersetzen würde. Von einer systematischen Aufarbeitung
kunsthistorischer Quellen ist die Forschung weit entfernt. Julius
von Schlossers Buch „Die Kunstliteratur“ (Wien 1924) ist ein 'Klassiker' der
Kunstwissenschaft. Dabei wollte Schlosser selbst seine Darstellung in
doppelter Hinsicht relativiert sehen: Zum einen sei nur ein Teilbereich der
kunsthistorischen Quellen erfasst. Zum anderen habe er sein eigentliches
Ziel, eine „Theorie und Geschichte der Kunstgeschichtsschreibung“, nur
andeuten können. Zu beiden Aspekten wurden seitdem entscheidende Beiträge
geliefert. Der Blick auf einzelne Texte, Gattungen, literarische Strukturen
und Zusammenhänge (Künstlerbiographie; ut pictura poesis) ist geschärft und
erweitert worden. Dennoch gibt es keine neue übergreifende Gesamtschau, die
Schlossers Darstellung ersetzen würde. Von einer systematischen Aufarbeitung
kunsthistorischer Quellen ist die Forschung weit entfernt.Die Arbeitstagung will neue Perspektiven der Beschäftigung mit den Quellen zur Kunst der Frühen Neuzeit öffnen. Verschiedenartige Gattungen von Text- und Bildquellen, Forschungsgeschichte und aktuelle Forschungsansätze werden vorgestellt und kritisch reflektiert. Das einjährige Bestehen der Publikationsreihe „FONTES. E-Quellen und Dokumente zur Kunst, 1350-1750“ auf dem Internet-Portal arthistoricum.net gibt zudem Anlass, über Bedeutung und Formen kunsthistorischer Quellen-Editionen nachzudenken. |
|||||
